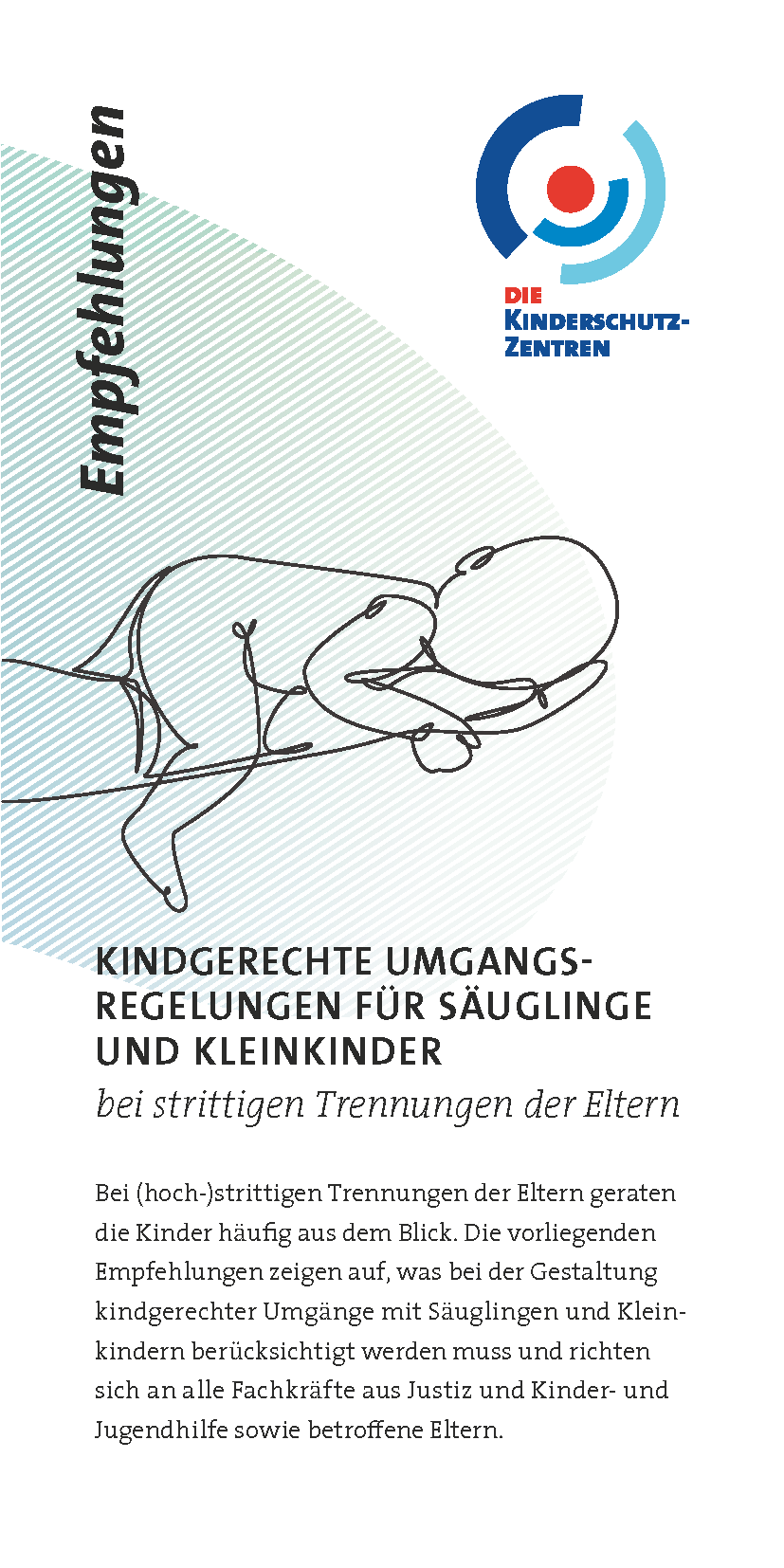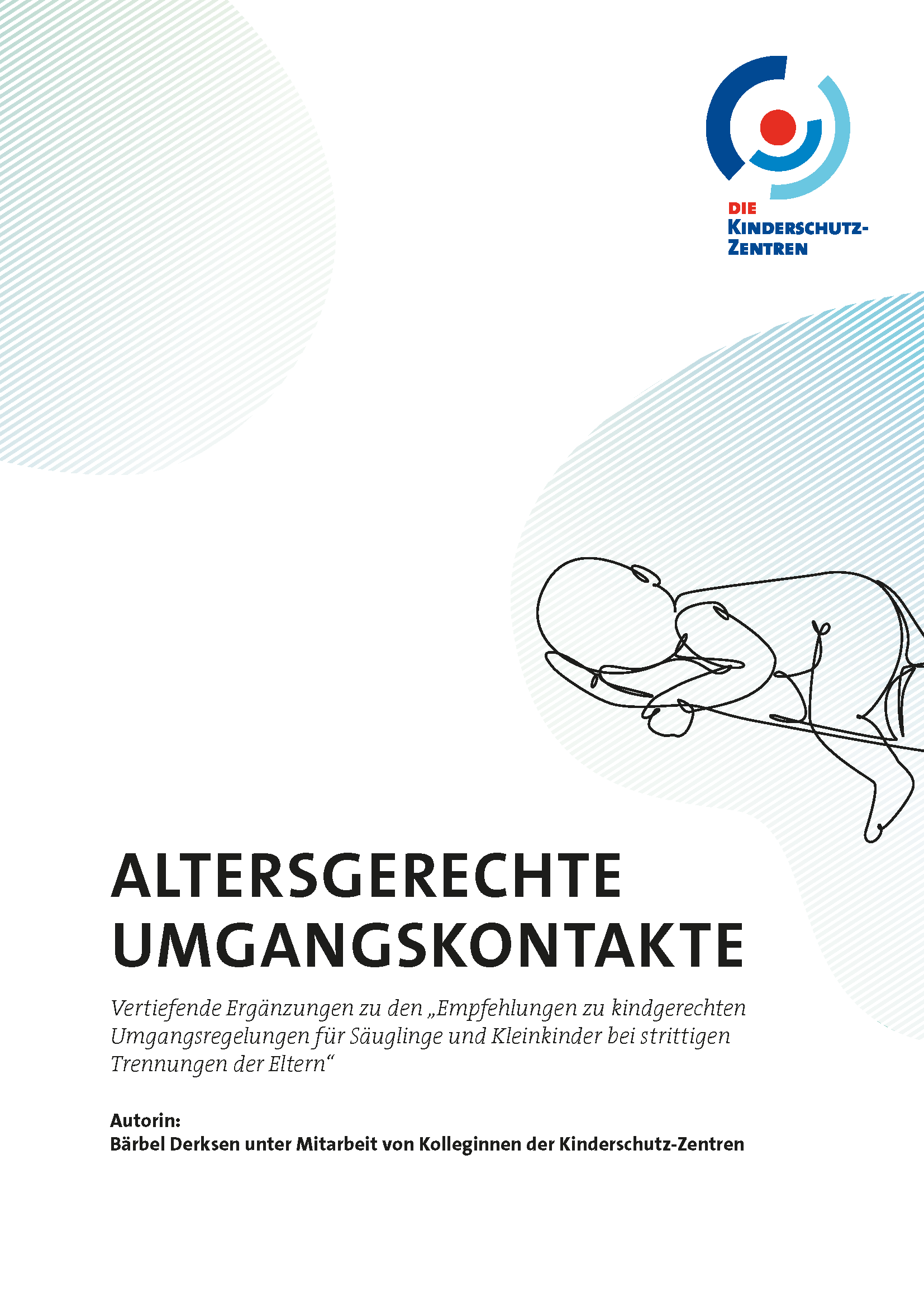In einem vielfältigen Programm widmeten sich der Thematik verschiedene Expert*innen aus Forschung und Praxis:
In dem Eröffnungsvortrag referierte Almut Fuest-Bellendorf vom Westfälisches Institut für Systemische Therapie und Beratung in Münster zur Arbeit mit hocheskalierenden Familiensystemen. Sie beschrieb sehr anschaulich, wie Eltern in eine Hochstrittigkeit geraten können und sich die Konflikte durch ihr eigenes Verhalten häufig weiter zuspitzen.
„Für Fachkräfte ist die Arbeit mit hochkonflikthaften Familiensystemen eine professionelle Gratwanderung: Mit den Familien in Kontakt und gleichzeitig gut abgegrenzt sein.“
Für die Berater*innen gab sie Empfehlungen in Bezug auf ihre eigenen Haltungen und ihr Verhalten. Dazu gehört unter anderem, die Konflikte der Eltern und die Konfliktdynamiken zu verstehen und Mediationsgrundlagen zu kennen. Wichtig sei immer auch die Unterstützung durch ein Team oder eine fachliche Begleitung sowie die Reflektion der Arbeit mittels Supervision.
In einem weiteren Beitrag wurde der Fokus auf die Auswirkungen der Hochstrittigkeit auf die Kinder gelegt. Prof. Dr. Sabine Walper vom Deutschen Jugendinstitut in München (DJI) stellte dazu einige empirische Befunde zu Ehescheidungen, Umgangskontakten zu getrenntlebenden Vätern und der Lebenszufriedenheit von Jugendlichen mit getrenntlebenden Eltern dar. Im Weiteren ging es um die Auswirkungen der Elternkonflikte auf die Kinder, die mit einer hohen emotionalen Unsicherheit einhergehen. Dabei zeigen sich starke Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung. Insbesondere dann, wenn Eltern heftige Konflikte im Beisein der Kinder führen, körperlich gewalttätig sind, häufig ohne effektive Lösungen streiten, die Kinder in Loyalitätskonflikte geraten oder es zu wiederholten gerichtlichen Auseinandersetzungen kommt. Prof. Walper zitierte mehrere Studien, die aufzeigen, dass Koalitionsdruck eines Elternteils auf das Kind seine Beziehung zu beiden Elternteilen belastet (der sogenannte „Bumerang-Effekt“).
In dem Beitrag von Prof. Dr. Ute Ziegenhain von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm wurde der Fokus auf die Auswirkungen von Hochstrittigkeit auf Säuglinge und Kleinkinder gelegt. Sie zeigte auf, dass es gerade in dieser hochsensiblen Entwicklungsphase zu großen Irritationen und Stressreaktionen führen kann und eine gesunde und optimale Entwicklung der Kinder bedroht ist. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, nach der Trennung der Eltern die Umgangsregelungen zum getrenntlebenden Elternteil und die Übergabesituationen den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand des Kindes anzupassen. Weitere Informationen finden Sie dazu auch in unseren Empfehlungen für kindgerechte Umgangsregelungen für Säuglinge und Kleinkinder bei strittigen Trennungen der Eltern.
Ute Bette von der KinSaFo – Fortbildung in Kindschaftssachen – in Wuppertal berichtete in ihrem Vortrag von ihren Erfahrungen als Verfahrensbeiständin zum Thema der Umgangsstörungen und Umgangsverweigerung seitens der Kinder. Anhand der Geschichten der Kinder, die sie begleitet hat, zeigte sie anschaulich die teils sehr verschiedenen Gründe, die zu einer Verweigerung des Umgangs führen können. Dazu gehören u. a. Loyalitätskonflikte, Ambivalenzen, Vermeidung von Konflikten der Eltern und auch die Belastung durch Gerichtsverfahren. Sie plädiert dafür, ein Verständnis für die Situation der Eltern zu entwickeln und sie „ins Boot zu holen“, wenn es um die Gestaltung der Umgänge geht. Und auch die Kinder sollten nach ihren Wünschen gefragt werden.
Prof. Dr. Alexander Lohmeier von der Technische Hochschule Rosenheim referierte zum Abschluss zum Thema „Humor als Interventionsstrategie und psychohygienischer Erfolgsfaktor in der Hochstrittigenberatung“. In seinem humorvollen Beitrag zeigte er kreative Möglichkeiten auf, wie Humor in der Beratung helfen kann, eine bessere Beziehung zu den Klient*innen aufzubauen, eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen und verhärtete Konfliktsituationen zu entschärfen oder sogar zu lösen. Dazu geht er auch auf die Voraussetzungen der „Humoranwendung“ ein, sowie auf „Humorfallen“. Zu den Voraussetzungen gehören zum Beispiel das gemeinsame Lachen über Probleme und ein „guter Draht“ zu den Klient*innen. Zu den Humorfallen gehören z. B. Eigeninszenierung und Dauergeblödle, Überzeichnungen, die nicht als solche erkannt werden, sowie die Nutzung von Humor als „Technik“. Humor in der Beratung müsse für die Klient*innen immer klar erkennbar sein und solle sich immer auf ein Thema und niemals auf eine Person beziehen.